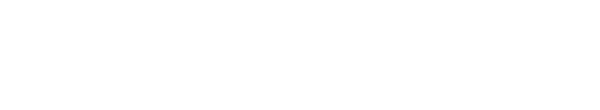Häusliche Gewalt und Psyche
Studienleitung: Assoc.Prof.in Priv.Doz.in Dr. Nilufar Mossaheb, MSc.
Weltweit haben 35% der Mädchen und Frauen körperliche und/oder sexuelle Gewalt erfahren. Frauen mit Gewalterfahrungen entwickeln deutlich häufiger psychische Erkrankungen. Umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit lebenszeitlich Opfer häuslicher oder sexueller Gewalt zu werden für Frauen mit psychischen Erkrankungen im Vergleich zu Frauen aus der Allgemeinbevölkerung um das 6-fache erhöht. Das Gesundheitswesen ist eine der wichtigsten Anlaufstellen für gewaltbetroffene Menschen auf der Suche nach Unterstützung.
Im Rahmen dieses Projektes sollen Wissen, Einstellungen und aktuelle Umsetzung beim Erfragen von Gewalt bei im psychiatrischen Kontext Tätigen erfasst werden.
Projektteam: Dr. in Antonia Renner, Dr. in Judit Deri, Dr.in Elisa Förster, Dr. Thomas Beck, Sabine Eder
Assoziierte Publikationen:
Gewalt gegen Frauen und ihre psychischen Auswirkungen.
Mossaheb, N.
psychopraxis. neuropraxis 27, 169–174 (2024).
https://doi.org/10.1007/s00739-024-01004-4
Der Einfluss des Dopamin-Agonisten Pramipexol auf die menschliche Kognition: eine systematische Literaturrecherche
Studienleitung: Dr.med.univ. Alexander Kaltenboeck, MSc. DPhil.
Der Dopamin-D2/D3-Rezeptor-Agonist Pramipexol, der primär zur Behandlung motorischer Symptome der Parkinson-Erkrankung und des Restless-Legs-Syndroms verwendet wird, könnte zukünftig eine mögliche Behandlungsoption für Menschen mit therapieresistenter Depression darstellen. Bisherige Studien zeigen, dass Pramipexol sowohl bei gesunden Menschen als auch in klinischen Populationen verschiedene neurokognitive Prozesse, insbesondere in Zusammenhang mit der Verarbeitung von belohnenden Erfahrungen, beeinflussen kann. Ziel dieses Projekts ist es, den derzeitigen Wissensstand zu kognitiven Effekten von Pramipexol systematisch zu erfassen und zu beschreiben. Auf diese Weise könnten potentielle kognitive Mechanismen antidepressiver Wirksamkeit bei Pramipexol identifiziert werden.
Projektteam: Dr.in Magdalena Grömer, Dr. in Carina Bum, Dr. in Sabine Weber, Dr. in Melanie Trimmel, DDr. Daniel König-Castillo
Assoziierte Publikationen:
https://link.springer.com/article/10.1007/s00213-024-06567-z
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322323013562?via%3Dihub
https://academic.oup.com/ijnp/article/25/9/720/6590902?login=true
https://www.mdpi.com/1424-8247/14/8/800
Treatment patterns in incident bipolar disorder in immigrant groups and host-population
Kollaborationsprojekt mit Karolinska Institute, Department of Clinical Neuroscience
Projektleitung: Prof.Dr. Ellenor Mittendorfer-Rutz (Karolinska Institute, Department of Clinical Neuroscience)
Ansprechpartner Sozialpsychiatrie: Apl. Prof. PD Dr. A. Kautzky
Psychische Erkrankungen werden oftmals nicht gemäß der publizierten klinischen Leitlinien behandelt. Unterschiede in der Versorgung von Patient:innen zeigen sich dabei unter anderem in Abhängigkeit psycho-soziodemographischer Faktoren wie dem sozioökonomischen Status, der ethnischen Herkunft und des Migrationshintergrundes. Im Rahmen des Projektes werden Daten der schwedischen Gesundheitsregister herangezogen, um Muster der psychopharmakologischen Behandlung bei bipolarer Störung darzustellen und Ungleichheiten zwischen in Schweden geborenen Patient:innen und solchen mit Migrations- und Flüchtlingshintergrund aufzuzeigen.
Homepage: REMAIN - Refugee Minors and Integration | Karolinska Institutet (ki.se)
Assoziierte Publikationen:
Treatment Patterns for Incident Bipolar Disorder Among Nonrefugee Immigrants, Refugees, Second-Generation Immigrants, and Host Population in Sweden.
Kautzky A, Pettersson E, Amin R, Akhtar A, Tanskanen A, Taipale H, Wancata J, Gemes K, Mittendorfer-Rutz E.
Bipolar Disord. 2025 May;27(3):192-204. doi: 10.1111/bdi.70007.
Refugee Emergency: DEFining and Implementing Novel Evidence-based psychosocial interventions
Studienleitung: Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata
Die RE-DEFINE-Studie (Refugee Emergency: DEFining and Implementing Novel Evidence-based psychosocial interventions), gefördert von der Europäischen Union, hat die Prävention psychischer Erkrankungen bei Flüchtlingen und Asylsuchenden zum Ziel. Flüchtlinge und Asylsuchende haben besondere Vorbelastungen, welche das Risiko für die Entwicklung psychischer Krankheiten begünstigen. Dazu gehören nicht nur die traumatisierenden Erlebnisse im Herkunftsland (z.B. Krieg, Folter, Misshandlung und Tod nahestehender Menschen), sondern auch die manchmal nicht weniger belastenden Erfahrungen während der Flucht (z.B. Lebensgefahr, Gewalt und Diskriminierung). Flüchtlinge und Asylsuchende leiden daher gehäuft unter posttraumatischen Störungen, Depressionen und Angsterkrankungen. Ziel des RE-DEFINE-Projekts ist es daher, die Wirksamkeit einer neuartigen Intervention zu untersuchen, die das Entstehen psychischer Krankheiten bei Flüchtlingen und Asylsuchenden verringern soll. SELF-HELP PLUS (SH+) ist eine diagnose-unspezifische psychosoziale Intervention, die dazu beitragen soll, mit Stress besser umzugehen, und auf diese Weise psychische Erkrankungen vermeiden soll. SH+ wurde von der Weltgesundheitsorganisation WHO speziell für diese Menschen entwickelt und wird in Gruppen von jeweils 10 bis 30 Teilnehmer:innen angeboten. Sowohl die Wirksamkeit als auch die Kosteneffektivität wird in zwei großen, multizentrischen randomisiert-kontrollierten Studien getestet. Neben führenden Wissenschafter:innen ausländischer Universitäten in Italien, Großbritannien, Finnland, Deutschland, Niederlanden und der Türkei arbeiten außerdem die Weltgesundheitsorganisation WHO und das Dänische Rote Kreuz mit, deren Expertise von Psychiatrie, Psychologie, Gesundheitsökonomie, Public Health bis zu Pflegewissenschaften reicht. Die Studie wird vom Forschungsprogramm „Horizon 2020 Research and Innovation Programme“ der Europäischen Union gefördert. Angesichts der großen Zahl von Flüchtlingen in Europa und im Nahen Osten ist RE-DEFINE von besonderer Bedeutung, da es mittelfristig zu einer Entlastung der Gesundheitssysteme beitragen könnte.
Weitere Information zu dieser Studie finden Sie unter: http://re-defineproject.eu/
Assoziierte Publikationen:
https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2023.1295031/full
https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/20008066.2024.2355828?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://mentalhealth.bmj.com/content/26/1/e300672
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00207640221132430?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-psychiatric-sciences/article/longterm-effectiveness-of-selfhelp-plus-in-refugees-and-asylum-seekers-resettled-in-western-europe-12month-outcomes-of-a-randomised-controlled-trial/CF75434D71FC6CAC2B05D12085A1C0D3
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2792120
https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-psychiatric-sciences/article/preventing-the-mental-health-consequences-of-war-in-refugee-populations/ECE017AE6C8B8B9C9D2DCB39667270AC
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wps.20939
https://www.tandfonline.com/doi/10.1080/20008198.2021.1930690?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://karger.com/pps/article/90/6/403/821140/Effectiveness-of-Self-Help-Plus-in-Preventing
https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-psychiatric-sciences/article/efficacy-and-acceptability-of-psychosocial-interventions-in-asylum-seekers-and-refugees-systematic-review-and-metaanalysis/E74C3894D0E811EAC29B14BE5538D19E
https://bmjopen.bmj.com/content/9/5/e030259.long
Theory of Mind bei Patient:innen mit somatoformen Störungen im Vergleich zu nicht-klinischen Proband:innen und Patient:innen mit anderen psychiatrischen Störungsbildern. Systematischer Review.
Studienleitung: Dr.in Marion Aichberger
Das Ziel des Projekts ist die systematische Literaturrecherche nach der Guideline für "Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)" sowie die kritische Evaluierung der vorhandenen empirischen Studien über die Theory of Mind (ToM) Fähigkeit von Patient:innen mit somatoformen Störungen (F45) nach ICD-10 und somatischer Belastungsstörung (F45.1-2; F45.8-9) nach DSM-V. ToM bezieht sich auf die menschliche Fähigkeit, anderen von uns unabhängige mentale und emotionale Zustände zuzuschreiben und anhand dieser, ihr Verhalten vorhersagen und interpretieren zu können. Die Zuschreibung von Gedanken, Meinungen und Absichten wird als kognitive, die von Emotionen als affektive ToM definiert. Dementsprechend wird die ToM-Fähigkeit als Grundvoraussetzung für alltägliche zwischenmenschliche Interaktionen erachtet. Sie wurde bei unterschiedlichen psychiatrischen Störungen, unter anderen bei den somatoformen Störungen untersucht, bis dato sind jedoch keine systematischen Reviews oder Meta-Analysen bekannt. Die bisherige Studienlage – trotz der methodologischen Uneinheitlichkeit (besonders betreffend die Diagnostik und die ToM Erhebungsmethoden) – lässt auf Defizite der affektiven ToM bei Patient:innen mit somatoformen Störungen schließen, die sich häufig in der Form des „Übermentalisierens“ (over-mentalizing) äußern. Diese Defizite können eine prägende Rolle bei der Entstehung von Schwierigkeiten in sozialen und Behandlungssituationen spielen und dadurch zur sozialen Isolation, zum Therapieabbruch und indirekt zur Aufrechterhaltung klinischer Symptome beitragen. Das bessere Verständnis der spezifischen ToM-Defizite bei somatoformen Störungsbildern kann in der Zukunft gezielte therapeutische Ansätze ermöglichen.
Projektteam: Dr.in Krisztina Kocsis-Bogar, Dr.in Judit Deri
Die Rolle von Framing und Geschlechterstereotype in der Medienberichterstattung über Femizide in Österreich
Studienleitung: Assoc. Prof.in Priv. Doz.in Dr.in Nilufar Mossaheb, M.Sc.
Die Zahl der Femizide in Österreich liegt deutlich über dem EU-Durchschnitt. Die Istanbul-Konvention und die Wiener Deklaration über Femizid betonen die Bedeutung einer geschlechtersensiblen Medienberichterstattung als Teil umfassender Präventionsstrategien.
Das Projekt untersucht, welche Geschlechterstereotype und Kausalitätsannahmen in österreichischen Printmedien über Femizid vermittelt werden und inwieweit dabei schädliche und protektive Erzählstile verwendet werden. Auch wird geprüft, inwieweit die Berichterstattung den bestehenden Leitlinien zu Berichterstattung über Gewalt gegen Frauen entspricht, und diskutiert, inwieweit diese Leitlinien auf Berichterstattung über Gewalt gegen Frauen übertragbar sind. Weiters wird untersucht, wie unterschiedliche Erzählstile die Wahrnehmung von Täter und Opfer sowie die Einstellung zu wirksamen Präventionsmaßnahmen beeinflussen.
Ziel ist es, wissenschaftliche Grundlagen für eine verantwortungsvolle, geschlechtersensible und präventionsorientierte Berichterstattung über Femizid zu schaffen.
Dieses Projekt wird in Kooperation mit der Unit Suizidforschung & Mental Health Promotion am Zentrum für Public Health durchgeführt.
Projektteam: Dr.in Judit Déri, Assoc. Prof.in Dr.in Michaela Wagner-Menghin, Mag.a Dr.in BA MA Brigitte Naderer, Dr.in Antonia Renner, Dr.in Elisa Förster, Univ.-Prof. Dr. Thomas Niederkrotenthaler, PhD MMSc, Assoc. Prof. Priv.-Doz. Mag. Dr. Benedikt Till
Selbststigmatisierung bei Personen mit Zwangserkrankung: eine quantitative Studie zum Effekt, eines achtwöchigen, verhaltenstherapeutisch-basierten Turnusprogramm auf die Selbstschädigung und kontextuelle Outcome-Parameter
Studienleitung: Prof. Dr. Dietmar Winkler
Studienteam: Claus Köpf MSc, BSc., Dr. Alexander Kaltenböck, Assoc.Prof.in Priv.Doz.in Dr. in Nilufar Mossaheb
Die psychosozialen und individuellen Auswirkungen der Stigmatisierung von Menschen mit Zwangsstörung sind umfassend und tragen vor allem dazu bei, dass sich die Betroffenen kaum oder spät an Hilfe wenden. Die Konsequenzen der Selbststigmatisierung, welche aus den Erfahrungen mit Stigmata resultiert, können tiefgreifende Einschnitte in das Leben der Patient:innen bedeuten. Das Hauptziel der Studie ist es den Effekt eines achtwöchigen, verhaltenstherapeutisch basierten Turnusprogramms auf die Selbstwertschädigung und relevante Outcome-Parameter zu untersuchen, sowie wie den Einfluss von Alter, Krankheitsdauer, Therapieerfahrung, depressiver Symptomatik und initialer Schwere der Zwangssymptomatik zu erforschen.