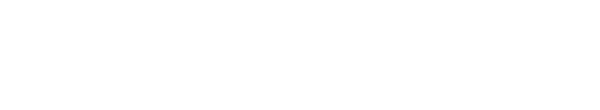Der Einfluss der COVID- 19 Pandemie auf den Inhalt von Ängsten von Patient*innen mit verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen - Eine explorative Pilotstudie
Der Einfluss der COVID- 19 Pandemie auf den Inhalt von Ängsten von Patient*innen mit verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen - Eine explorative Pilotstudie
Studienleitung: Assoc.Prof.in Priv-Doz. in Dr. in Nilufar Mossaheb, M.Sc
Die globale COVID-19 Pandemie hat signifikante Auswirkungen auf verschiedene Determinanten psychischer Gesundheit, die kurz, mittel- und langfristige Konsequenzen haben und haben werden. Menschen mit schweren psychiatrischen Erkrankungen sind im Rahmen der Pandemie vermehrtem psychosozialen Stress ausgesetzt. Wenngleich psychische Auswirkungen von Pan- und Epidemien und anderer tragischer Massenereignisse nicht nur unmittelbar auf Menschen mit vorbestehenden psychischen Erkrankungen relevante Auswirkungen haben, sondern meistens viel länger nachwirken als das Ereignis an sich, sind die Maßnahmen zur Erforschung, Erfassung, Unterstützung und Behandlung Ersterer meist unzureichend.
Studienziel: Erfassung von COVID-19 assoziierten wahnhaften und nicht wahnhaften Ängsten (Angst- und Wahninhalten) in einem Kollektiv von Patient*innen mit verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen, die mit ebenjenen Symptomen einhergehen, konkret: Personen mit psychotischen Erkrankungen, mit bipolar affektiven Störungen, mit unipolar affektiven Störungen, sowie mit Angst- und Zwangserkrankungen.
Laienfreundlicher Text: Ziel dieser Untersuchung ist die Erfassung der Auswirkung der COVID-19 Pandemie auf Inhalte von nicht-wahnhaften und wahnhaften Ängsten bei Patient*innen mit verschiedenen psychiatrischen Erkrankungen.
Projektteam: Dr. Fabian Friedrich
Förderung: Medizinisch-wissenschaftlicher Fonds des Bürgermeisters des Stadt Wien
Somatische Komplikationen von Alkoholkonsumstörungen
Somatische Komplikationen von Alkoholkonsumstörungen
Studienleitung: DDr. Daniel König-Castillo
Vermehrter Alkoholkonsum ist einer der wesentlichsten Faktoren für vorzeitigen Tod für die Altersgruppe der 15-49-Jährigen. Trotz vieler Bemühungen steigt der Anteil der Bevölkerung mit problematischem Alkoholkonsum weiter an. Dies führt dazu, dass alkoholbedinge Lebererkrankungen mittlerweile der häufigste Grund für eine Lebertransplantation in Europa darstellen. Ziel der Projekte ist es zu untersuchen, inwieweit Geschlechterunterschiede den Schweregrad der Folgeerkrankungen von vermehrtem Alkoholkonsum und schließlich auch das Überleben beeinflusst.
Assoziierte Publikationen:
https://www.mdpi.com/2077-0383/11/13/3646
https://link.springer.com/article/10.1007/s40211-020-00364-8
https://academic.oup.com/alcalc/article/54/6/593/5554634https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468125324003807?via%3Dihub
Einfluss von SARS-CoV-2 und der Maßnahmen der Österreichischen Bundesregierung auf die psychische Gesundheit
Einfluss von SARS-CoV-2 und der Maßnahmen der Österreichischen Bundesregierung auf die psychische Gesundheit
Studienleitung: Apl.Prof. Priv Doz. Dr. Alexander Kautzky
Die anhaltende Ausbreitung von SARS-CoV-2 führte zu von der Bundesregierung verhängten Maßnahmen welche als beispiellos in der Geschichte der Republik Österreich angesehen werden müssen. Dementsprechend ist von gravierenden Folgen insbesondere der Kombination von gesundheitlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen insbesondere auf vulnerable Gruppen auszugehen. Dieser Einfluss wird in verschiedenen Patient*innenkollektiven der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie untersucht. Der Fokus liegt dabei auf Stress, depressiven Symptomen, Suizidgedanken, psychotischen Symptomen, Alkohol- und Substanzgebrauch, Aufmerksamkeitsstörungen sowie Hyperaktivität. Weiters soll die Auswirkung auf soziale Unterstützung, Zugang zur und Kontinuität der psychiatrischen und psychotherapeutischen Betreuung, sowie den sozioökonomischen Status, und das Zusammenspiel dieser Faktoren mit dem psychischen Wohlbefinden, erfasst werden. Die Erkenntnisse des Projektes können dabei sowohl der besseren psychiatrischen Versorgung innerhalb der fortdauernden Pandemie dienen, als auch zu präventiven Maßnahmen für künftige Krisensituationen beitragen.
Integrierte Versorgung von Post Covid-19 Patient*innen in Wien – Epidemiologie, leistungsphysiologische Erhebung und Effekt ambulanter pneumologischer Rehabilitation auf Leistungsparameter, Angst und Depression
Integrierte Versorgung von Post Covid-19 Patient*innen in Wien – Epidemiologie, leistungsphysiologische Erhebung und Effekt ambulanter pneumologischer Rehabilitation auf Leistungsparameter, Angst und Depression
Kollaborationsprojekt mit Therme Wien Med
Projektleitung: Prim. Dr. Ralf-Harun Zwick (Therme Wien Med)
Ansprechpartner Sozialpsychiatrie: Apl. Prof. PD Dr. A. Kautzky
Postvirale Syndrome nach Infektion mit Covid-19 sind häufig und schränken den Alltag der Betroffenen oftmals stark ein. Psychiatrische Symptome wie Angst, gedrückte Stimmung und Fatigue sind dabei sowohl besonders häufig als auch belastend. Im Rahmen dieses Projekts werden u.a. der Effekt ambulanter Rehabilitation auf die psychische Gesundheit von Patient:innen mit post-Covid Syndrom und Risikofaktoren für unzureichenden Behandlungserfolg erforscht.
Förderung: Medizinisch-wissenschaftlicher Fonds des Bürgermeisters der Stadt Wien
Assoziierte Publikationen:
Sex differences of post-Covid patients undergoing outpatient pulmonary rehabilitation.
Kautzky A, Nopp S, Gattinger D, Petrovic M, Antlinger M, Schomacker D, Kautzky-Willer A, Zwick RH.
Biol Sex Differ. 2024 Apr 21;15(1):36. doi: 10.1186/s13293-024-00609-z.
The role of cholesterol-lowering drugs in the regulation of steroid hormones and related diseases
Kollaborationsprojekt mit Universitätsklinik für Innere Medizin III
Projektleitung: Priv.Doz. Dr. Michael Leutner (Univ.Klinik für Innere Med III)
Ansprechpartner Sozialpsychiatrie: Apl.Prof. PD Dr. A. Kautzky
Hyperlipidämie ist ein wesentlicher Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen und Lipidsenker gehören zu den weltweit am häufigsten verordneten Medikamenten. Insbesondere für Statine wurde eine Vielzahl protektiver Effekte berichtet die auch die psychische Gesundheit betreffen, im Hochdosisbereich durch übermäßige Eingriffe in den Steroidhormonhaushalt und Senkung von Cholesterin jedoch möglicherweise auch ein Risiko für Depression. Im Rahmen des Projekts soll an Patient:innen mit Hyperlipidämie welche lipidsenkende Therapie starten u.a. untersucht werden, inwiefern protektive und ungünstige Effekte auf die psychische Gesundheit von Dosis und Typ der Medikation abhängen.
Kognitive Funktion, Lebensqualität (HRQL), Psychopathologie und psychologische Flexibilität (PF) in Patientinnen mit gynäkologischen Malignomen in Behandlung mit zytotoxischer Chemotherapie oder Immuntherapie (CPI).
Kooperationsprojekt Univ. Klinik für Frauenheilkunde / Univ. Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Klinische Abteilung für Sozialpsychiatrie
Studienleitung: Dr.in Krisztina Kocsis-Bogar, Dr. Andreas Wippel
Chemotherapien können mit einer zumeist vorübergehenden Einschränkung der Konzentrations-, Denk- und Merkfähigkeit einhergehen ("Chemobrain"). Diese kann durch testpsychologische Untersuchungen nachweisbar sein oder wird vorwiegend subjektiv erlebt. In entsprechenden Patient:innenkollektiven kommt es häufiger zu depressiven Symptomen, Angstsymptomen und generell zu einer reduzierten Lebensqualität. Neuere Substanzen wie Immun-Checkpoint-Inhibitoren und deren Auswirkungen auf die kognitive Leistungsfähigkeit wurden noch nicht hinreichend erforscht. Unter psychologischer Flexibilität (PF) versteht man die Fähigkeit, die eigenen Gedanken und Emotionen zu akzeptieren, in der Gegenwart zu bleiben und nach den eigenen Werten zu handeln. Dies kann es für das Individuum erleichtern, sich an situative Herausforderungen anzupassen. Sie wird in der Psychotherapie von PatientInnen mit Krebserkrankungen adressiert und korreliert negativ mit depressiven Symptomen und Angst. Die Studie hat zum Ziel Patientinnen, welche entweder ein Chemotherapeutikum oder eine Immuntherapie im Rahmen einer gynäkologischen Krebserkrankung erhalten, testpsychologisch zu untersuchen um dabei die objektive und subjektiv erlebte kognitive Leistungsfähigkeit, gesundheitsbezogene Lebensqualität, die depressive und Angstsymptomatik sowie die PF zu messen. Wir hoffen, einen Beitrag zum besseren Verständnis über die Auswirkung von Krebserkrankungen und/oder Chemotherapeutika/Immuntherapie auf die kognitive Leistungsfähigkeit und deren Zusammenhang mit psychopathologischen Symptomen zu leisten. Hierdurch ergibt sich ein möglicher Beitrag zur Verbesserung der Effektivität von Psychotherapie bei onkologischen Patientinnen.
ME/CFS versus Depression (FATIGEAT)
ME/CFS versus Depression (FATIGEAT)
Dietary Supplementation for Fatigue Symptoms in Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome and Depression - an Exploratory Study
In dieser explorativen Studie sollen selbsterfasste phänomenologische Unterschiede zwischen ME/CFS und Depression erfasst werden. Darüber hinaus soll das Hilfesuchverhalten und die bisher angewandten Behandlungsmöglichkeiten auf ihre Unterschiede zwischen den beiden Gruppen und die subjektive Effektivität untersucht werden.
Die Studie wird in einer Kooperation zwischen der Karl Landsteiner Private University for Health Science und dem Research Centre for Transitional Psychiatry und der Klinischen Abteilung für Sozialpsychiatrie, der Univ. Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen Universität Wien durchgeführt.
Projektteam: Marie Celine Dorczok, MSc., Assoc.Prof.in PD Dr.in Lucie Bartova, Priv.Doz.in Dr.in Beate Schrank, MSc. PhD, Assoc.Prof.in PD Dr.in Nilufar Mossaheb, MSc., Dr.in Mag.a Verena Steiner-Hofbauer
Assoziierte Publikationen:
Dietary Supplementation for Fatigue Symptoms in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)—A Systematic Review
MC Dorczok, G Mittmann, N Mossaheb, B Schrank, L Bartova, M Neumann, V Steiner-Hofbauer
Nutrients 2025, 17(3), 475;
https://doi.org/10.3390/nu17030475
https://www.mdpi.com/2072-6643/17/3/475
EPSICO - Psychiatrische Komorbiditäten und Lebensqualität bei Patient:innen mit Indikation zur Epilepsiechirurgie
EPSICO - Psychiatrische Komorbiditäten und Lebensqualität bei Patient:innen mit Indikation zur Epilepsiechirurgie
Erfassung psychiatrischer Krankheitsbilder und Symptome sowie der Beeinträchtigungen und der Lebensqualität bei Patient:innen mit therapierefraktärer Epilepsie, wobei jenen Patient*innen die operiert wurden und jene, die nicht operiert wurden, verglichen werden.
Projektteam: Assoc.Prof.in PD Dr.in Nilufar Mossaheb, MSc., Dr. Fabian Friedrich,
Ao.Univ.Prof.in. Dr.in Ekaterina Pataraia, MBA, Ass.Prof.in Dr.in Susanne Aull-Watschinger, Assoc.Prof.in Dr.in Mag.a Susanne Zehetmayer
Förderung: Medizinisch-Wissenschaftlichen Fonds des Bürgermeisters der Bundeshauptstadt Wien
Assoziierte Publikationen:
Psychiatric symptoms and comorbidities in patients with drug-resistant epilepsy in presurgical assessment-A prospective explorative single center study
F Friedrich, E Pataraia, S Aull-Watschinger, S Zehetmayer, L Weitensfelder, C Watschinger, N Mossaheb
Front Psychiatry. 2022 Oct 6:13:966721. doi: 10.3389/fpsyt.2022.966721. eCollection 2022.
https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2022.966721/full
Bewegungsstörungen bei nichtmedizierten Patient:innen mit psychotischer Erstmanifestation und Hochrisiko Patient:innen
Bewegungsstörungen bei nichtmedizierten Patient:innen mit psychotischer Erstmanifestation und Hochrisiko Patient:innen
Ziel der Studie ist bei noch unmedizierten Patient:innen mit psychotischer Erstmanifestation oder einem at-risk mental state das Vorliegen etwaiger neurologischer Zeichen und/oder Hinweise für Bewegungsstörungen zu evaluieren, zu erfassen und standardisiert zu klassifizieren. Die Untersuchung soll dabei helfen, die Phänomenologie etwaiger Bewegungsstörungen bei unmedizierten Patient:innen zu beschreiben, und etwaige Medikationseffekte hernach transdisziplinär besser interpretieren zu können.
Die Studie erfolgt als Kooperation zwischen der Univ. Klinik für Neurologie und der Klinischen Abteilung für Sozialpsychiatrie.
Projektteam: Dr. Christoph Brücke, PhD, Dr. Fabian Friedrich, Assoc.Prof.in PD Dr.in Nilufar Mossaheb, MSc.